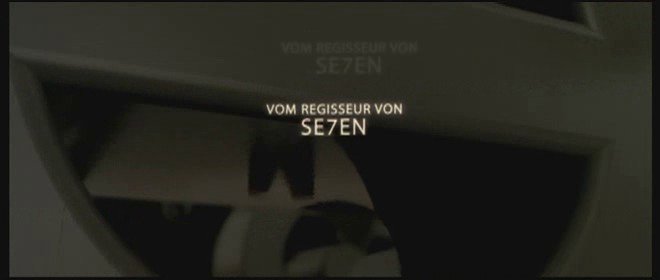Auch Serienkiller stehen unter Leistungszwang. Im Kino verbraucht sich ihr Schrecken rasch durch die Gewöhnung des Publikums an den folgenlosen Bilderkonsum, und so will jeder neue Film über einen Serienmörder grausiger, spektakulärer, schauwertpraller als der Vorgänger sein. David Finchers „Zodiac - Die Spur des Killers“ verweigert sich dieser Eskalationsstrategie, der Spirale schockierender Perversionsdarstellung - von den ersten Szenen an.
David Fincher, bisher durchaus ein Spezialist für extreme Welt- und Seelenzustände, wählt eine nüchterne, unterkühlte Erzählweise. Er signalisiert uns in der Montage vieler kleiner Momentaufnahmen, dass er sich bei der Verfilmung des True-Crime-Buches von Robert Graysmith über die Zodiac-Morde in Nordkalifornien eher journalistischen Kriterien verpflichtet fühlte als den Dramaturgie-Rezepten des Thrillers. Er nimmt dabei billigend in Kauf, dass sein Publikum suggestiven Spannungsaufbau, identifikationsstiftende Heranführung an positive Charaktere und Klarheit schaffende psychologische Zergliederung der Hauptfiguren vermissen könnte.
David Finchers Rezept ist so schlüssig wie riskant: Er dreht den herkömmlichen Thriller von innen nach außen. In der Schilderung der Ermittlungsarbeit, im Zusammenbau der Indizien, in der Einkreisung des Täters demonstrieren Krimis die Handlungsgewalt von Menschen, deren Fähigkeit, einer verwirrenden Wirklichkeit Herr zu werden. Sie zeigen, was ihre Protagonisten mit dem Fall machen. Fincher geht umgekehrt vor: Er zeigt, was der Fall mit seinen Protagonisten macht.
Dabei verweigert er fast kaltschnäuzig die Innensicht oder die große Seelenbeichte. Er schaut seinen Polizisten und Journalisten beim Ermitteln zu, so lange es geht, und zeigt dann relativ unvermittelt, dass es nicht mehr geht. Ein Cop gesteht seinem Partner abrupt, dass dies der letzte gemeinsame Arbeitstag war, dass er sich in eine andere Abteilung hat versetzen lassen; ein extravaganter Starjournalist verliert durch seine Trinkfreude den Job und lässt seinen ehemaligen Kollegen genau in jenem Moment abblitzen, aus dem eine nicht den Fakten verpflichtete Dramaturgie Läuterung, Wiedereinstieg in die Ermittlung und Aufklärung des Falles ableiten würde.
In „Zodiac“ entzieht sich der Kriminalfall selbst permanent der eindeutigen Aufklärung. Es fällt kein Licht auf den Fall, es fallen nur grelle Schlaglichter auf die Ermittler. Doch, obwohl „Zodiac“ vom Verfall, der Besessenheit, der Resignation und dem Scheitern der Ermittler erzählt, weigert er sich, diese Ermittler jenseits des Falls zu zeigen, also zum runden Menschenporträt zu werden. Er schildert nur das Akten-Relevante, erzählt also in Momenten der Machtlosigkeit der Menschen vor allem von der Macht des ungelösten Rätsels. Ein individueller Kriminalfall ohne politische Motive generiert so Muster und Atmosphäre des klassischen Verschwörungsthrillers, entwickelt den Grusel einer trotz überall umher liegender Faden-Enden nicht mehr entwirrbaren Welt.
In Figurenzeichnung und Konstruktion spiegelt „Zodiac“ Alan J. Pakulas „All The President’s Men - Die Unbestechlichen“ aus dem Jahre 1976, nur dass er die große Systemkrise nach Richard Nixons Manipulation der demokratischen Prozesse privatisiert und verallgemeinert. Nicht mehr ein korrupter Präsident an der Spitze des Staates, sondern ein x-beliebiger Serienmörder lässt die ganze Welt als gefährlich undeutbar und von abgrundtiefen Fallen durchwirkt erscheinen.
David Finchers Film verlässt sich bei der Präsentmachung einer vergangenen Ära nicht auf grelle Schlüsselreize, auf ikonenhafte Bilder der Hippie-Jahre in Kalifornien. Mit seltener Präzision erweckt die Ausstattung Stadt- und Arbeitsleben einer anderen Zeit zum Leben. Die Autos wirken nicht museal, die Straßen nicht wie mühsam abgesperrte Dekorationszonen, die Büros nicht wie Requisiten-Arrangements. Trotzdem ist in der sinnlich belebten Welt dieses Films beständig die gestalterische Hand spürbar, wird unser Blick vom Regisseur geführt, auf kleine Hinweise auf den Wechsel des Zeitgeists oder auf das Älterwerden der Ermittler. Wie nebenbei etwa nimmt die Kamera ein grellbuntes Pepto-Bismol-Fläschchen auf einem Schreibtisch mit ins Bild. Nun wissen wir, dass der zugehörige Mensch mittlerweile ein nervöses Magenproblem oder ein Geschwür entwickelt hat. Der Verzicht auf Musik, die nicht zur Szene selbst gehört, die nicht von den Figuren selbst gehört wird, verstärkt anfangs den authentischen Charakter der Inszenierung.
Robert Downey jr. und Jake Gyllenhaal spielen mitten in einem Mosaik-Ensemble treffsicher besetzter Charaktere ihre beiden Journalisten mit einer erstaunlichen Verweigerung an Habt-mich-lieb-Mechanismen. Das übereifrige, fast manische Interesse von Gyllenhaals Jungjournalist an einem Fall, über den er als Karikaturist eigentlich gar nicht zu berichten hat, wirkt so heilsam befremdlich wie die arrogante Selbstgewissheit von Downeys Top-Reporter. Wie letzterer anfangs als Dandy auftritt, wie er später Kleidersignale der Hippies übernimmt, wie einer mitten im Apparat der Redaktion seine Unbürgerlichkeit demonstriert, aber damit eher verloren, fremdbestimmt und charakterschwach als trotzig und konsequent wirkt, das wäre anderswo Stoff für ein eigenes Drama. Hier wird es uns nebenbei in kleinen Andeutungen erzählt.
Nicht allen Mitgliedern der FBW-Jury schien diese Erzählweise immer originell, bewusst und kontrolliert. Das Ausgestellte der kühlen Erzähl-Haltung, die Wiederholung einer Krimi-Verweigerung, die schon Friedrich Dürrenmatt durch exerziert hat, und ein Desinteresse an den wahren Motiven und Gefühlen der Figuren ließen ihnen „Zodiac“ eher als verunglückt erscheinen. Solch grundlegende Einwände fand die Mehrheit des Ausschusses nur gegen das letzte Drittel des Films. Dort nämlich wird Fincher seiner vorherigen Erzählweise untreu, er bricht seinen Stil und leistet somit der Interpretation Vorschub, nicht jede kühle Zuschauer-Distanzierung durch Schnitt, Kameraführung und Szenen-Auswahl sei zuvor gewollt gewesen.
„Zodiac“ setzt gegen Ende suggestive Musik ein, um Szenen zu ordnen, Handlungen zu kommentieren, unsere Gefühle zu lenken. Die Ausbreitung der Fakten weicht dem Zuordnen von Wertungen. Wenn Jake Gyllenhaal bei einem Filmsammler sehr symbolisch in den Keller des Hauses hinab steigen muss, wenn er nicht nur im finsteren Intimbereich eines momentan höchst Tat Verdächtigen landet, sondern auch im Unterbewusstsein der Medienindustrie selbst, dann ist das zwar eine clever konstruierte Sequenz. Aber wie nun zu einer kalifornischen Mordserie die beständigen fiktionalen Schrecken Hollywoods als Wurzelgrund suggeriert werden, wie die Szenenfolge selbst als Paraphrase von „The Most Dangerous Game“ (Regie Irving Pichel und Ernest B. Schoedsack) aus dem Jahr 1932 gelesen werden kann, das zerstört mit seiner Symbolik die Nüchternheit der True-Crime-Erzählung.
Obendrein zieht Fincher die inszenatorischen Zügel an. Er will im Moment Hollywoodscher Selbstreflexion eine Komik des Schreckens heraus inszenieren. Er gibt die Panik des Journalisten, die Gruselschloss-Aura des Verdächtigen und die Möglichkeit, der Ermittler könnte sich ins Innere der Falle hinein recherchiert haben, dem Gelächter preis. Für sich selbst makellos inszeniert, passt diese Szene nicht in „Zodiac“: Fincher beeinträchtigt zugunsten von Einzeleinfällen die Gesamtwirkung.
Solcher Stilbrüche wegen, die das Projekt des distanzierten Antikrimis mit Nähe schaffenden Thriller-Elementen in Frage stellen, hat die Mehrheit der FBW-Jury nach ausführlicher und leidenschaftlicher Diskussion das höchste Prädikat nicht erteilt.
„Zodiac“ ist ein ausgesprochen sorgfältig gemachter, wagemutig konzeptionierter True-Crime-Film, sehenswert und verstörend, der sich nicht auf den Wettlauf der Schockshows, sondern auf das gesellschaftskritische Hollywood der Siebziger bezieht. Doch er könnte noch besser und eindringlicher sein, wenn er sich konsequenter an seine eigenen Vorgaben, Blickwinkel und Erzähltechniken hielte.
Quelle: Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW)