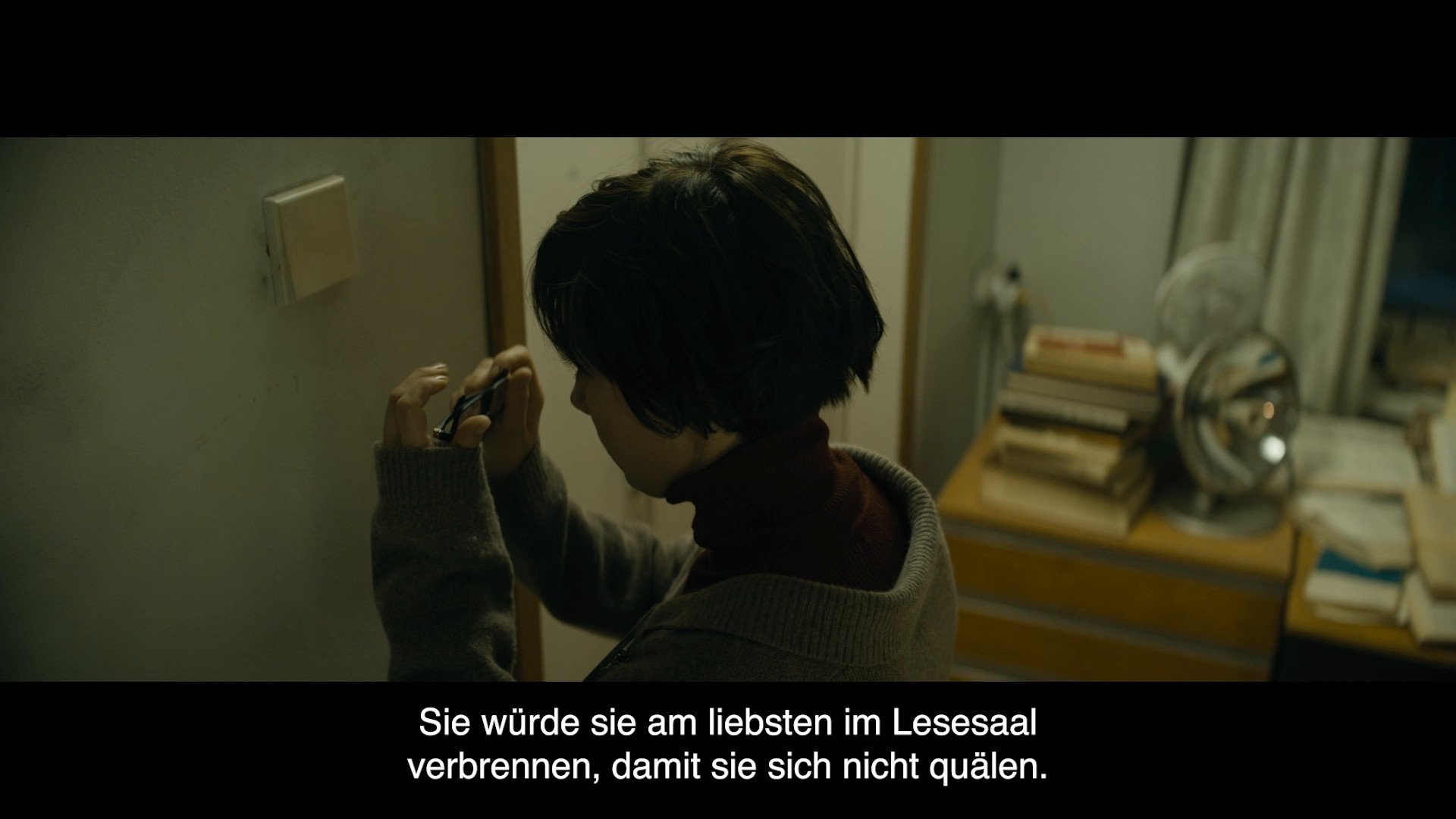Petrov's Flu - Petrow hat Fieber: Romanverfilmung von Kirill Serebrennikov, in dem eine von Grippe geplagte Familie im postsowjetischen Russland ihre gewöhnlichen Tage fristet und dabei außergewöhnlichen Geheimnissen hütet.
Der russische Regisseur Kirill Serebrennikov kehrt drei Jahre nach „
Leto“ mit „Petrov’s Flu“ in den Wettbewerb des Festival de Cannes zurück, bei dem einem dessen Fantasie förmlich um die Ohren fliegt. Die Bilder explodieren in alle Richtungen, mit einer so unbändigen und wilden und rücksichtslosen Energie, dass man sich bisweilen an seinen Kinosessel klammert, weil man fürchtet, man könne weggerissen werden von dem Trip durch eine urbane winterliche Höllenlandschaft. Ein Vergnügen ist sie nicht, diese massive Frontalattacke auf alle Sinne, mit ihrer entfesselten Kamera, den schreienden, ins Bild und wieder hinaus stolpernden Gestalten, dem bis zum Anschlag aufgedrehten Sound und den ständigen Perspektiv- und Szenenwechseln, die das Team des Regisseurs in einer logistischen und kreativen Meisterleistung orchestriert hat. Keine Atempause, Chaos wird gemacht. Ein Film, als würde einem der Zahnarzt auf einen offenen Nerv gehen.
Petrov hat eine Grippe, die er einfach nicht loswird. Er hustet und schnieft und rotzt und schwitzt mehr als der Landpfarrer in Bergmans „
Licht im Winter„. Das will etwas heißen. Mit dem hatte man schon nicht tauschen wollen. Petrov ist ein Häufchen Elend, aber er ist immer in Bewegung. Einen Tag in seinem Leben folgt ihm der Film. Aber was heißt das schon, wenn nie klar sein kann, ob das Gezeigte gerade wirklich passiert, eine vom Fieber induzierte Fantasie oder eine Erinnerung ist oder die Vorstellung davon, dass es eine Erinnerung sein könnte. Gleich in der ersten Szene stolpert Petrov aus einem voll besetzten Bus und wird von einer Miliz rekrutiert, an einem Erschießungskommando teilzunehmen: Ein paar reiche Säcke sollen zahlen. Rattatattatatat. Echt? Nicht echt? Egal. Serebrennikov hat es gefilmt, wir haben es gesehen. So geht es weiter. Jede Einstellung atmet Krankheit, Fäulnis, Gewalt, eine Gesellschaft löst sich von innen heraus auf. Einen ätzenderen Kommentar auf das Russland von heute könnte man sich kaum vorstellen. Ein gescheiterter Schriftsteller begeht Selbstmord, Petrov hilft, den Abzug zu ziehen. Eine Bibliothekarin erledigt einen rüden Besucher mit ein paar coolen Martial-Arts-Moves und prügelt ihn zu Matsch - habe ich im Kino gesehen, sagt sie. Vielleicht ist sie aber auch eine echte Superheldin, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Stadt von gewalttätigen Männern zu befreien. Da hat sie viel zu tun. Wenn das wirklich so sein sollte, dann weiß zumindest Petrov nichts davon. Menschen haben auf offener Straße Anfälle. Es wird geschrien, gesoffen, geraucht. Tote befreien sich allein aus ihren Särgen. Alles normal, nichts zu sehen, weitergehen.
Bei diesem Durcheinander, auf das Robert Altman stolz wäre, als hätte eine der surrealen Sozialsatiren Bunuels Tollwut bekommen, ist es nicht immer leicht, den Überblick zu bewahren, die Zusammenhänge zu erkennen, die vielen Rätsel zu lösen, die der Film aufgibt. Das ist aber auch nicht unbedingt wichtig. Weil die Botschaft trotzdem ankommt: Der beißende Sarkasmus ist so radikal, dass Kirill Serebrennikov nicht einmal vor sich selbst Halt und seiner Arbeit als gefeierter Theaterregisseur am Gogol Zentrum in Moskau: Ein Trupp Schauspieler geriert sich wichtig, gespreizt - und entpuppt sich dann doch nur als Gruppe, die auf einem Kinderfest gute Laune macht. So inszeniert ein Mann, der in Flammen steht. Verständlich: Mehrere Jahre - während der Entstehung von „Leto“ - verbrachte er im ewigen Clinch mit den Autoritäten in Hausarrest; im vergangenen Jahr wurde er der Veruntreuung schuldig gesprochen und darf das Land nicht verlassen. Aber er darf Filme machen, die nach außen stülpen, wie es in ihm innendrin aussieht. Die Hölle kennt keinen Zorn, der schlimmer ist als der eines zum Äußersten getriebenen Filmemachers. Gut, dass Cannes ihm eine Bühne bietet.
Thomas Schultze.